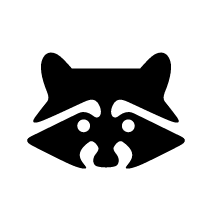Geschenke der Erde
Robin Wall Kimmerer flicht aus indigener Weisheit und wissenschaftlichen Erkenntnisse einen Zopf an Geschichten über die Großzügigkeit der Erde.
Einmal hörte ich, wie sich Evon Peter - ein Angehöriger der Gwich'in, Vater, Ehemann, Umweltaktivist und Häuptling von Arctic Village, einem kleinen Dorf im Nordosten Alaskas -, jemandem als »Junge, der an einem Fluss aufgewachsen ist« vorstellte. Die Formulierung ist glatt und rutschig wie ein Flusskiesel. Meinte er einfach nur, dass er in der Nähe seiner Ufer aufgewachsen war? Oder meinte er die Obhut des Flusses, hatte der Fluss ihn wachsen lassen, ihm beigebracht, was er fürs Leben brauchte? Aufgewachsen an einem Fluss: Ich vermute, beides stimmt - das eine geht kaum ohne das andere.
Ich wuchs bei und mit den Erdbeeren auf, mit ganzen Feldern davon. Nichts gegen die Ahorne, Hemlocktannen, Weymouth-Kiefern, Goldruten, Astern, Veilchen und Moose im Hinterland des Bundesstaates New York, aber mein Gefühl für die Welt und meinen Platz in ihr gaben mir die winzigen Scharlach-Erdbeeren,- die ich unter taunassen Blättern an Frühsommermorgen entdeckte. Hinter unserem Haus erstreckten sich, unterteilt durch Steinwälle, meilenweit alte Heuwiesen, die längst nicht mehr bewirtschaftet wurden, aber noch nicht zu Wäldern verbucht waren. Wenn der Schulbus unseren Hügel hinaufgetuckert war, warf ich meinen rot karierten Schulranzen in die Ecke, zog mich um, bevor meiner Mutter einfiel, was ich erledigen sollte, und sprang über den Bach, um bei den Goldruten spazieren zu gehen.
Unsere mentalen Landkarten enthielten alle Orientierungspunkte, die wir Kinder brauchten: das Fort unter dem Essigbaum, den Steinhaufen, den Fluss, die große Kiefer, deren Äste in so gleichmäßigen Abständen wuchsen, dass man bis in ihren Wipfel klettern konnte wie auf einer Leiter - und die Erdbeerplätze.
Im Mai, im Blütenmond, dem waabigwani-glizis, besprenkelten ihre weißen Blütenblätter mit gelber Mitte - wie eine kleine Wildrose - all das krause Gras. Wir merkten uns gut, wo sie standen, spähten auf dem Weg zum Fröschefangen regelmäßig unter die dreiteiligen Blätter, um zu prüfen, wie weit sie waren. Nachdem die Blüte endlich ihre Kronblätter abgeworfen hatte, erschien stattdessen ein winziger grüner Knubbel, und als die Tage länger und wärmer wurden, schwoll er zu einer kleinen weißlichen Beere an. Egal, wie sauer sie waren, wir aßen sie trotzdem, zu ungeduldig für das eigentliche Erlebnis.
Reife Erdbeeren roch man, bevor man sie sah, ihr Duft vermischte sich mit dem Geruch von Sonne auf feuchtem Boden. So roch der Juni, der letzte Schultag, wenn wir frei bekamen, und der Erdbeermond, ode 'mini-gizis. Ich lag auf dem Bauch an meinen Lieblingsstellen, sah zu, wie die Beeren unter den Blättern süßer und größer wurden. Jede winzige wilde Beere war kaum größer als ein Regentropfen, die Samen in kleinen Grübchen unter der Blätterkappe. Von diesem Blickwinkel aus konnte ich nur die allerrötesten pflücken und die hellroten für morgen stehen lassen.
Noch heute, über fünfzig Erdbeermonde später, bin ich gerührt und überrascht, wenn ich eine Stelle mit Scharlach-Erdbeeren finde. Mich überkommt ein Gefühl von Unverdientheit und Dankbarkeit für die Freigebigkeit und Freundlichkeit, die in diesem unerwarteten Geschenk in rot-grüner Verpackung stecken.
»Wirklich? Für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen.« Nach fünfzig Jahren werfen sie bei mir immer noch die Frage auf, wie ich auf ihre Freigebigkeit reagieren soll. Manchmal fühlt sich das nach einer dummen Frage an, mit einer ganz einfachen Antwort: Iss sie auf.
In unseren Schöpfungsgeschichten spielt die Herkunft der Erdbeeren eine wichtige Rolle. Die hübsche Tochter der Himmelsfrau, die sie aus der Himmelswelt in ihrem Bauch mitbrachte, wuchs auf der guten grünen Erde auf, voller Liebe und geliebt von allen anderen Wesen. Doch es kam zu einer Tragödie, denn sie starb bei der Geburt ihrer Zwillinge, Flint (Feuerstein) und Sapling (Bäumchen). Mit gebrochenem Herzen begrub die Himmelsfrau ihre geliebte Tochter im Boden. Ihr letztes Geschenk, unsere am meisten verehrte Pflanze, wuchs aus ihrem Leib. Die Erdbeere spross aus ihrem Herzen. Auf Potawatomi heißt die Erdbeere ode min, Herzbeere. Für uns ist sie die Anführerin der Beeren, die erste, die Frucht trägt.
Die Erdbeeren waren diejenigen, die mir das Gefühl gaben, dass die Welt voller Geschenke sei, die alle zu unseren Füßen lägen. Ein Geschenk erhält man ohne eigenes Zutun, umsonst, es kommt zu uns, ohne dass wir darum gebettelt haben. Es ist keine Vergütung, kein Lohn für Arbeit, kein eingelöster Anspruch, auch kein moralischer Verdienst. Und doch ist es da. Wir müssen nur die Augen offen halten und wach sein. Geschenke gehören ins Reich der Bescheidenheit und des Geheimnisses - wie bei zufalligen Freundlichkeiten wissen wir nicht, woher sie kommen.
Die Felder meiner Kindheit überschütteten uns mit Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, herbstlichen Pekannüssen, Sträußen von Wildblumen für meine Mutter, und boten sonntägliche Familienausflügen. Sie waren unser Spielgelände, Rückzug, Naturtempel, unser ökologisches Klassenzimmer und der Ort, wo wir lernten, Konservendosen vom Steinwall zu schießen. Alles umsonst. Zumindest dachte ich das.
Damals erlebte ich die Welt als Schenkökonomie, in der »Güter und Dienstleistungen« nicht erworben, sondern als Geschenk von der Erde empfangen wurden. Zum Glück war mir nicht bewusst, wie meine Eltern kämpfen mussten, um in der Lohnwirtschaft über die Runden zu kommen, die fernab von diesem Feld wütete.
In unserer Familie war das, was wir einander schenkten, fast immer selbst gemacht. Für mich war das sogar die Definition eines Geschenks: etwas, was man für jemand anderen machte. All unsere Weihnachtsgeschenke bastelten wir selbst: Sparschweine aus leeren Putzmittelflaschen, Topfuntersetzer aus kaputten Wäscheklammern, und Püppchen aus pensionierten Strümpfen. Meiner Mutter zufolge machten wir das, weil wir kein Geld für gekaufte Geschenke hatten. Für mich war es keine Entbehrung; es war etwas Besonderes.
Mein Vater liebte wilde Erdbeeren, weshalb meine Mutter ihm zum Vatertag fast immer einen Erdbeerkuchen machte. Sie buk den knusprigen Tortenboden und schlug die schwere Sahnecreme, aber wir Kinder waren für die Beeren verantwortlich. Jeder bekam ein oder zwei alte Marmeladengläser und verbrachte den Samstag vor dem Fest draußen in den Feldern, und es dauerte ewig, bis wir sie voll hatten, weil immer mehr Beeren in unseren Mündern landeten. Schließlich kamen wir heim und kippten sie auf dem Küchentisch aus, um die mitgebrachten Käfer herauszulesen. Bestimmt übersahen wir auch welche, aber Dad gab zu der Extraportion Protein nie einen Kommentar ab. Für ihn war Erdbeerkuchen das bestmögliche Geschenk, zumindest vermittelte er uns das. Es war ein Geschenk, das man niemals kaufen konnte. Als Kinder, die bei Erdbeeren aufwuchsen, war uns wahrscheinlich nicht klar, dass die Beerengabe vom Feld selbst kam, nicht von uns. Unser Geschenk waren Zeit und Aufmerksamkeit und Fürsorge und rot verklebte Finger. Herzbeeren, ja. Geschenke der Erde oder von jemand anderem begründen eine besondere Beziehung, eine Art Pflicht zum Geben, Empfangen, und zum Erwidern. Das Feld beschenkte uns, wir beschenkten Dad, und wir versuchten, wiederum die Erdbeeren zu beschenken. Wenn die Beerenzeit vorbei war, bildeten die Pflanzen schlanke Ausläufer aus, um neue Pflanzen wachsen zu lassen. Mich faszinierte, wie sie über den Boden krochen und nach der richtigen Stelle zum Wurzelschlagen suchten, und so jätete ich kleine Stellen frei, wo die Ausläufer den Boden berührten. Bald würde der Ausläufer kleine Wurzeln austreiben, und im Herbst würde es dann noch mehr Pflanzen geben, die im nächsten Erdbeermond blühen würden. Das brachte uns niemand bei - die Erdbeeren zeigten es uns selbst. Weil sie uns ein Geschenk gemacht hatten, entstand zwischen uns eine anhaltende Beziehung.
Die Farmer in unserer Gegend bauten massenweise Erdbeeren an und heuerten häufig Kinder an, um diese für sie zu pflücken. Meine Geschwister und ich radelten die lange Strecke zur Farm der Crandalls, um uns mit Erdbeerpflücken ein Taschengeld zu verdienen. Einen Zehner für jedes Kilo. Doch Mrs. Crandall war eine pingelige Chefin. Sie stand in ihrer Kittelschürze am Feldrand und gab uns Anweisungen, wie wir pflücken sollten und dass wir ja keine Beeren zertreten sollten. Und sie hatte noch andere Regeln. »Diese Beeren gehören mir«, sagte sie, »nicht euch. Ich will keinen erwischen, wie er meine Beeren isst.« Ich kannte den Unterschied: Auf den Feldern hinter unserem Haus gehörten die Beeren sich selbst. An ihrem Stand am Straßenrand verkaufte diese Dame sie für sechzig Cent das Kilo.
Das war eine echte Lektion in Sachen Ökonomie. Wir mussten einen Großteil unseres Lohns ausgeben, wenn wir in unseren Fahrradkörben Beeren nach Hause fahren wollten. Natürlich waren diese Beeren zehnmal so groß wie unsere wilden, aber nicht annähernd so gut. Ich glaube nicht, dass wir die Plantagenerdbeeren je für Dads Kuchen verwendet haben. Es hätte sich einfach nicht richtig angefühlt.